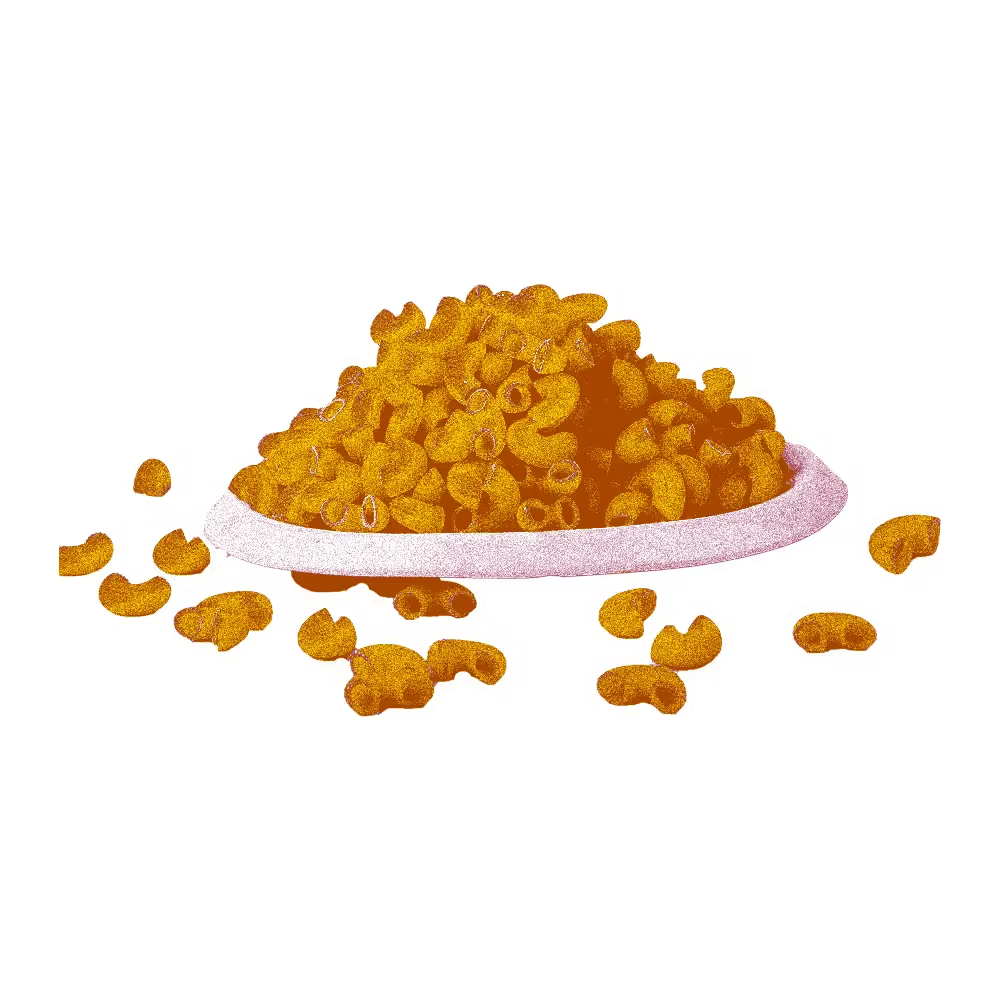Die Pfauenfeder war ein Symbol für Homosexualität, insbesondere für eine flamboyante, extravagante Männlichkeit. Sie wurde entweder direkt als Schmuckstück getragen, beispielsweise als Hutverzierung oder Anstecknadel, oder sie fand ihren Platz in Kunstwerken und Dekorationen. Der symbolische Bezug zur queeren Identität entstand durch das prachtvolle Federkleid männlicher Pfauen, das auffälliger und farbenfroher ist als das der Weibchen. Während bunte, opulente Mode im 21. Jahrhundert oft mit Weiblichkeit assoziiert wird, war dies historisch nicht immer der Fall. In bestimmten gesellschaftlichen Kreisen galt ein kunstvoller, exzentrischer Stil als Zeichen von Raffinesse und Individualität – Eigenschaften, die oft mit queeren Subkulturen verbunden wurden.

Vor allem Männer aus queeren Kreisen nutzten die Pfauenfeder als ein Zeichen für ihre Andersartigkeit und ihren ästhetischen Ausdruck. Sie fand unter Dandys des 19. Jahrhunderts, Künstlern und Mitgliedern der Bohème-Bewegung besondere Verbreitung. Männer, die mit ihrer Kleidung bewusst traditionelle Geschlechterrollen hinterfragten oder sich durch einen außergewöhnlichen Stil inszenierten, griffen auf dieses Symbol zurück. In der frühen queeren Szene wurden Pfauenfedern auch von schwulen Männern getragen, die sich mit ihrer Exzentrik von bürgerlichen Männlichkeitsbildern abgrenzten.

Die Nutzung der Pfauenfeder als Symbol für Homosexualität lässt sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen, als sich mit der Dandy-Kultur erstmals eine Gruppe von Männern etablierte, die sich durch einen bewussten, oft dekadenten Stil von der Mehrheitsgesellschaft absetzten. Besonders im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert gewann das Symbol an Bedeutung, als queere Ästhetik zunehmend in Kunst und Literatur Eingang fand. Die Verbindung der Pfauenfeder mit Homosexualität blieb bis ins 20. Jahrhundert in bestimmten Kreisen erhalten, bevor sie langsam aus dem sichtbaren Symbolrepertoire verschwand.

Besonders in Europa und Nordamerika war die Pfauenfeder als queer codiertes Symbol verbreitet. In Metropolen wie London, Paris oder Berlin, in denen sich queere Netzwerke formierten, wurde sie sowohl in Mode als auch in Kunst als Ausdrucksmittel genutzt. Die visuelle Symbolik tauchte in literarischen Salons, auf Theaterbühnen und in Illustrationen auf, wo sie bewusst als Zeichen von Extravaganz, aber auch von queerer Identität eingesetzt wurde.